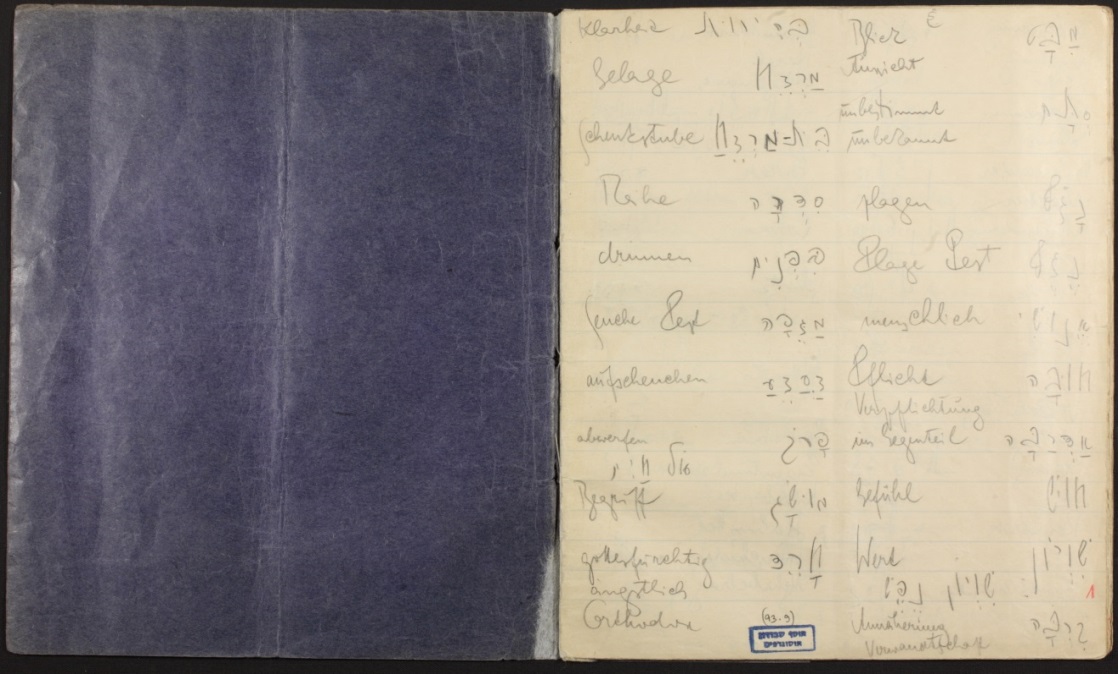Leonie Otto (Frankfurt am Main)
Ein Bericht für eine Akademie, Kafkas erstmalig 1917 veröffentlichte Schrift, wurde in den letzten Jahren häufig auf die Bühne gebracht. Obwohl von Kafka selbst nicht als Text für das Theater eingestuft, lässt der Bericht schnell an dieses denken: Er besteht von Anfang bis Ende aus einem Monolog, dem Bericht, den der Protagonist den „[h]ohe[n] Herren“[1] einer nicht näher bestimmten Akademie vorträgt. Dieser Protagonist ist ein sprechender Affe, Rotpeter genannt. Bei einer „Jagdexpedition der Firma Hagenbeck“ an der „Goldküste“ (beide 301) wurde er gefangen genommen und referiert seinen gelehrten Zuhörern nun, in der Szene, die der Text entwirft, wie es ihm gelang, „in fünf Jahren das Affentum ab[zu]werfen und die ganze Menschheitsentwicklung durchzugaloppieren“[2].
Von besonderem Interesse für eine theaterwissenschaftliche Beschäftigung mit dem Bericht für eine Akademie ist aber nicht nur die von Kafka gezeichnete Situation dieses Auftritts, sondern auch der Inhalt des vom Affen in gewählten Worten formulierten Vortrags. Kafka stellt den Affen als Künstler dar, der seine Evolution – so meine These – als eine Subjektwerdung nach dem Gesetz der zivilisatorischen Choreographie referiert. Dabei komprimiert der Vortrag einen umfassenden Diskurs über ein Verhältnis zum Körper, das von dessen (Selbst-)Disziplinierung und dessen Fremdheit gleichermaßen bestimmt ist. Von einer Choreographie der Zivilisation zu sprechen, wird dabei von Kafka mit der umfassenden Beschreibung, die Rotpeter über seine Formung nach Normen menschlichen Bewegens und Verhaltens vorbringt, aus heutiger theater- und tanzwissenschaftlicher Sicht geradezu nahegelegt. Denn die Geschichte der Selbstdisziplinierung eines auf der Grenze zwischen Mensch und Tier tanzenden Affen weist erstaunliche Parallelen zu einer aktuellen Lesart des frühen Begriffs von Choreographie auf, die Gerald Siegmund in kritischer Auseinandersetzung mit André Lepecki vorgelegt hat.
Im Folgenden soll, ausgehend von diesem Choreographie-Begriff eine Lektüre des Kafka-Texts vorgenommen werden, die sich darauf konzentriert, wie Kafka mittels der Figur des Affen und Künstlers Rotpeter auf wenigen Seiten verdichtet einfängt, inwiefern in der abendländischen Kulturgeschichte das, was als menschlicher Körper anerkannt wurde, niemals feststand, sondern anhand von Ausschlüssen festgesetzt und verfestigt wurde.
Choreographie als Gesetz der Menschwerdung
In einem Kapitel von Exhausting Dance. Performance and the Politics of Movement arbeitet André Lepecki heraus, dass die „Orchésographie“[3] – etymologisch der Vorläufer des seit Beginn des 18. Jahrhunderts und der Gründung der französischen Akademien verbreiteten Wortes „Choreographie“ – im 1588 veröffentlichten Lehrbuch des Franzosen Thoinot Arbeau „als Nachbearbeitung des Körpers“[4] verstanden werde, das heißt als Vorschrift von Bewegung „zur Disziplinierung des Körpers, der sich entsprechend der niedergeschriebenen Anweisungen bewegt“.[5] Der Priester und Tanztheoretiker Arbeau will damit junge Männer zu angemessenen Manieren und vorzeigbaren Bewegungen anleiten, um sie auf den Eintritt in die Gesellschaft vorzubereiten.[6] Gerald Siegmund, der sich im Aufsatz „Recht als Dis-Tanz: Choreographie und Gesetz in William Forsythes Human Writes“ auf Lepeckis Arbeau-Lektüre bezieht, arbeitet heraus, dass Arbeau in der den Anleitungen zu verschiedenen Gesellschaftstänzen vorausgehenden Einleitung die Sorge artikuliere, „ohne den Tanz nur Tier zu bleiben“.[7] Die Orchésographie beziehungsweise Choreographie verhelfe, so Siegmund, als „das Gesetz des sich bewegenden Körpers“[8] zu einer gesellschaftlich anerkannten weil als menschlich anerkannten Gestalt:
Nur weil es die Choreographie gibt, kann ich den richtigen gesellschaftlichen Umgang lernen. Sie ist der Grund für mein richtiges Verhalten, weil sie mir einen Körper gibt, in dem mein nicht gesellschaftsfähiger, tierischer Körper aufgehen kann.[9]
Bei Kafka beschreibt der Affe Rotpeter eine solche Grundlage des richtigen Verhaltens als „die Richtlinie […], auf welcher ein gewesener Affe in die Menschenwelt eingedrungen ist und sich dort festgesetzt hat“ (300). Die Grenze zwischen Mensch und Tier wird also als eine durchlässige, wenn auch aus der Richtung des Affen nur in Ausrichtung an einer choreographischen Vorschrift zur Erlangung eines gesellschaftsfähigen Körpers überwindbare beschrieben. Von der Seite der Menschen aus betrachtet ist die Grenze nicht minder durchlässig, wie nicht nur die von Siegmund bei Arbeau bemerkte Sorge nur Tier zu bleiben zeigt, sondern auch Theodor W. Adorno und Max Horkheimer in einem Fragment der Dialektik der Aufklärung, betitelt mit „Mensch und Tier“[10] konstatieren. Sie beschreiben die kontinuierliche Nachzeichnung dieser Grenze als notwendig für den westeuropäischen Anthropozentrismus:
Die Idee des Menschen in der europäischen Geschichte drückt sich in der Unterscheidung vom Tier aus. Mit seiner Unvernunft beweisen sie die Menschenwürde. Mit solcher Beharrlichkeit und Einstimmigkeit ist der Gegensatz von allen Vorvorderen des bürgerlichen Denkens, den alten Juden, Stoikern und Kirchenvätern, dann durchs Mittelalter und die Neuzeit hergebetet worden, daß er wie wenige Ideen zum Grundbestand der westlichen Anthropologie gehört. Auch heute ist er anerkannt.[11]
Obgleich die hier angesprochenen Unterscheidungen den Begriff des Menschen von dem des Tiers abzugrenzen suchen, schreiben sie beiden meist eine gemeinsame Basis zu: den Körper in seiner Animalität. Durch die Bestimmung einer „anthropologische[n] Differenz“[12] wird der Mensch als Tier „plus x“[13] definiert. Seit Aristoteles gilt der Mensch als das vernunftbegabte Tier – zoon logon echon,[14] oft übersetzt als animal rationale[15] –, seit Descartes’ als das beseelte Tier, welches mit den wie ein Automat funktionierenden Körper gemein habe.[16]
Kafka stellt das am häufigsten diskutierte Kriterium zur Definition dieser anthropologischen Differenz, den logos, also den Besitz von Vernunft, Verstand und Sprechvermögen, hinten an und verlagert die Differenzen, mit denen die Grenze zwischen Mensch und Tier konstituiert wird, auf die Ebene der Körper. Allerdings werden Körper dabei als nicht naturgegeben, sondern kulturell hergestellte entlarvt, wenn Rotpeter, der sprechende Affe, beschreibt, welche erlernten Unterschiede er in Bewegungen, Verhalten und Haltung zwischen Menschen und Affen beobachtet. Aus diesen Beobachtungen bringt er sich den richtigen gesellschaftlichen Umgang weitestgehend selbst bei. Den Bericht für eine Akademie ausgehend vom Begriff der Choreographie zu lesen, lenkt das Augenmerk darauf, dass Kafka beziehungsweise Rotpeter die philosophischen Grenzziehungen zwischen Mensch und Tier, die mit dem Sprachvermögen oder der Vernunft argumentieren, nicht übernimmt, sondern durch die Fokussierung auf Körper, die sich an Idealen und Regeln ausrichten und nicht naturgegeben sind, jene Grenzziehungen als ebenso fragile wie durchlässig markiert.
Die Figur des sprechenden und zivilisierten Affen Rotpeters unterscheidet sich von den anderen kafkaschen Tieren, da die im Bericht für eine Akademie aus der Ich-Perspektive rückblickend erzählte Transformation weniger eine „Tier-Werdung“ als eine „Mensch-Werdung“ ist.[17] Die Spezies „Affe“ ist dabei von Kafka wohlweislich gewählt. Die Kategorie der Primaten bildet bei Grenzziehungen zwischen Mensch und Tier eine Grauzone, spätestens seitdem der schwedische Naturforscher Carl von Linné in seiner 1776 erschienenen Klassifikation der Lebewesen sowohl Menschen als auch Menschenaffen der Gruppe der Anthropomorpha (später ersetzt durch den Begriff der Primaten) zuordnete.[18] Auch Linnés Zeitgenosse Jean-Jacques Rousseau konstatiert eine ausgedehnte Ununterscheidbarkeit von Menschen und Affen. Im Jahr 1753 will er, im Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes aus seinen Überlegungen über den „Naturzustand“[19] eine „Genealogie der Soziabilität“[20] und eine „Rekonstruktion der Menschwerdung“[21] erarbeiten, um zu zeigen, dass Ungleichheit aus Vergesellschaftung erklärt und nicht als natürlich Gegebenes und Unabänderliches begriffen werden sollte. Im Zusammenhang mit der für seine Argumentation grundlegenden Frage, was ein Mensch sei, erörtert Rousseau in seinen ausführlichen Anmerkungen der Frage nach, wie und ob sich „der wilde Mensch“[22] von „anthropoformen Tierarten“[23] unterscheide. Eine Passage des Buchs Histoire générale des Voyages,[24] die die Orang-Utangs im Königreich Kongo als den Menschen sehr ähnlich beschreibt, lässt Rousseau zweifeln,
ob verschiedene den Menschen ähnliche Lebewesen, die von den Reisenden ohne lange Prüfung für Tiere gehalten wurden – entweder aufgrund einiger Unterschiede, die sie in der äußeren Beschaffenheit bemerkten, oder bloß deshalb, weil diese Lebewesen nicht sprechen –, nicht in Wirklichkeit wahrhaft wilde Menschen waren, deren Rasse, in alten Zeiten in den Wäldern zerstört, keine Gelegenheit gehabt hätte, irgendeine ihrer virtuellen Fähigkeiten zu entwickeln, keinerlei Grad von Vollkommenheit erlangt hatte und sich noch im anfänglichen Naturzustand befand.[25]
Es sei nicht ersichtlich, warum die Autoren der Voyages
den in Frage stehenden Tieren die Bezeichnung ‚Wilde Menschen‘ […] verweigern, aber es ist leicht zu vermuten, wegen deren Stupidität und auch, weil sie nicht sprechen – schwache Grüne für die, die wissen, daß obschon das Organ der Sprache den Menschen natürlich ist, die Sprache selbst ihm gleichwohl nicht natürlich ist, und die sich darüber im klaren sind, bis zu welchem Punkt seine Perfektibilität den bürgerlichen Menschen über seinen ursprünglichen Zustand hinaus gehoben haben kann.[26]
Nachdem diese längeren Überlegungen weitreichende Gemeinsamkeiten von Affen und wilden Menschen zusammentragen, kommt Rousseau überraschenderweise doch zum Schluss, dass es ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen Menschen und Affen gebe:
Wie dem auch sei, es ist gut nachgewiesen, daß der Affe keine Varietät des Menschen ist, nicht nur, weil er der Fähigkeit zu sprechen beraubt ist, sondern vor allem, weil man sicher ist, daß seine Art nicht die Fähigkeit hat, sich zu vervollkommnen, die das spezifische Charakteristikum der menschlichen Art ist.[27]
Gerade diese Fähigkeit, sich zu vervollkommnen sticht auch als Charakteristikum der Rotpeter-Figur in seinem im Folgenden noch detaillierter wiedergegebenem Bericht über seine Selbstdisziplinierung hervor. Gleichzeitig scheint sich Rotpeter aber, auch darauf soll nun eingegangen werden, darüber im Klaren zu sein, dass das was man mit Siegmund seinen nicht gesellschaftsfähigen, tierischen Körper nennen könnte, nicht ganz im erlernten, als menschlich akzeptierten Körper aufgehen kann – ohne, dass man ihn andererseits irgendwie unter diesem wieder freigelegen könnte.
Unterwerfung und Hervorbringung durch die Choreographie
Rotpeters erste an die „Herren von der Akademie“ (299) gerichteten Sätze machen deutlich, dass er mit seiner Abhandlung auf ihre Aufforderung, einen Bericht über seine Ursprünge auf dem afrikanischen Kontinent einzureichen, antwortet. Genaugenommen besteht seine Antwort allerdings nur darin, dass er deutlich macht, dass die Frage falsch gestellt ist. Er könne dieser Aufforderung nicht nachkommen, erklärt Rotpeter und bietet als alternative Antwort die Nacherzählung seiner Assimilation an die Menschen in Europa an, die er selbst als eine Erfolgsgeschichte schildert, die sowohl sein Erlangen der „Durchschnittsbildung eines Europäers“ (312) als auch das Erlangen von Ruhm auf allen „großen Varietébühnen der zivilisierten Welt“ (301) umfasst.
Kafkas Leserinnen und Leser lernen erst diesen retrospektiv berichtenden, menschenähnlich gewordenen Rotpeter kennen. Sein „neue[s] Leben“ (303) sei nämlich, so Rotpeter, durch eine mit jedem Schritt seiner Verwandlung vergrößerte, zunächst von seinen Jägern und Wächtern, dann von der eigenen Assimilation verstellte Kluft von seinem „äffische[n] Vorleben“ (299) getrennt:
War mir zuerst die Rückkehr, wenn die Menschen gewollt hätten, freigestellt durch das ganze Tor, das der Himmel über der Erde bildet, wurde es gleichzeitig mit meiner vorwärts gepeitschten Entwicklung immer niedriger und enger; wohler und eingeschlossener fühlte ich mich in der Menschenwelt; der Sturm, der mir aus meiner Vergangenheit nachblies, sänftigte sich; heute ist es nur noch ein Luftzug, der mir die Fersen kühlt; und das Loch in der Ferne, durch das er kommt und durch das ich einstmals kam, ist so klein geworden, daß ich, wenn überhaupt die Kräfte und der Wille hinreichen würden, um bis dorthin zurückzulaufen, das Fell vom Leib mir schinden müßte, um durchzukommen. (299 f.)
So beschreibt Rotpeter eine Spanne von nahezu fünf Jahren – „eine Zeit, kurz vielleicht am Kalender gemessen, unendlich lang aber durchzugaloppieren, so wie ich es getan habe“ (299), – die ihn unwiderruflich von den Ursprüngen, über die die Akademiker etwas zu erfahren wünschen, abgeschnitten hat. Rotpeter versteht, im Unterschied zu ihnen, dass ein vermeintliches Außerhalb der Zivilisation stets nur als Konstruktion, ex negativo gedacht werden kann. Mit Jacques Derrida wäre diese Annäherung an den Naturzustand, die diesen als Gegenteil und Ergänzung der Kultur entwirft, als supplement zu bezeichnen. Derrida legt das Wort supplement in einer Lektüre von Rousseaus Emile frei und versteht es als Addition und Substitution eines Begriffs um sein Anderes, erst aus ihm selbst Abgeleitetes, welches damit aber die Leerstelle eines so nie dagewesenen und doch verloren geglaubten Ursprungs markiert.[28]
Selbst wenn Rotpeter den Willen und die Kräfte zu einer Rückkehr aufbrächte, würde er auf dieser „anderen Seite“ also wieder als Fremder eintreffen, durch den Verlust des Fells, das ihn bei den Menschen noch als Affen kennzeichnet, nun wiederum gegenüber den anderen Affen als Mensch gekennzeichnet. Und doch weiß Rotpeter darum, dass sich die eigene Animalität ebenso wenig, wie er zu ihr zurückkehren kann, vollständig negieren lässt. Vom leisen Wind aus früheren Zeiten bleibe niemand völlig unerreicht, betont er an die ihm zuhörenden Männer gerichtet:
Ihr Affentum meine Herrn, sofern Sie etwas Derartiges hinter sich haben, kann Ihnen nicht ferner sein als das meine. An der Ferse aber kitzelt es jeden, der hier auf Erden geht, den kleinen Schimpansen wie den großen Achilles. (300)
Auch noch an die Gefangennahme durch die Jäger der Hagenbeckschen Expedition hat Rotpeter selbst keine Erinnerung, sondern weiß davon durch „fremde Berichte“ (301). Solche Berichte waren zur Entstehungszeit von Kafkas Texten zum Rotpeter-Thema tatsächlich zahlreich vorhanden, wie in biographischen Ansätzen der Kafkalektüre gerne nachgewiesen wird. Hartmut Binder zeichnet nach, dass Zeitungsberichte über verschiedene Experimente mit „denkenden Pferden“ sowie der auch in Prag vorgeführte dressierte Schimpanse namens Konsul Peter (auf den Rotpeter an einer Stelle selbst verweist (vgl. 301)) Kafka bekannt gewesen sein müssen.[29] Der Name der Jagdexpedition, die Rotpeter an der Goldküste gefangen nimmt, verweist außerdem auf eine historische Figur: Carl Hagenbeck, nicht nur Tierhändler und -dresseur, sondern auch Veranstalter von Völkerschauen. Bei einer Lektüre von Hagenbecks Darstellungen seiner zoologischen Projekte und Tierdressuren verblüfft, wie viele Motive des Bericht für eine Akademie schon hier anzutreffen sind. So beispielsweise die dressierten Menschenaffen als Weinliebhaber, der „kluge […] Schimpanse […] Moritz“[30] oder das „schöne[n] Orangpaar Jacob und Ronja“, dem sein anthropomorphes Verhalten zu Zugeständnissen verhalf – durch die sie aber wiederum weiter anthropomorphisiert wurden:
Ihnen wurde volle Freiheit gewährt, sie bildeten Mitglieder der Familie […]. Als sie nach Europa überführt wurden, blieben sie während der Reise die ganze Nacht frei an Bord, sie konnten hingehen, wo es ihnen beliebte […].[31]
Der Blick in derartige Dokumente aus der Entstehungszeit des Bericht für eine Akademie zeigt, dass die von Kafka entworfene Welt gerade in der Zuspitzung von Vorgefundenem entsteht, das Kafka nur an wenigen Stellen weiterdreht. Die wichtigste Stellschaube, an der Kafka dreht, ist hier, dass er den dressierten Affen, um den es in seinem fiktiven Bericht geht, dazu ermächtigt, selbst zu berichten. So komprimiert er die Spannung zwischen dem Unterdrücken und dem Unterdrücktwerden der Animalität, zwischen dem Wunsch, die zu beherrschen und einer Faszination für sie, die ihre anthropozentrische Perspektive nicht verlassen kann, in einer Figur. Indem er Rotpeter eine Stimme verleiht, lässt er ihn als im zweifachen Sinne selbstbewussten Künstler auftreten. Gerade mit diesem Empowerment geht aber einher, dass Rotpeters Erlernen der zivilisatorischen Choreographie nicht allein als Dressur, sondern als Selbstdisziplinierung dargestellt wird, das heißt, dass Kafka ein besonderes Augenmerk auf das legt, was Rousseau die den Menschen ausmachende Fähigkeit, sich zu vervollkommnen, nennt – welche von Kafka ambivalenter beschrieben wird als von Rousseau.
Rotpeters Rückblick setzt also mit der Begegnung mit der zivilisierten Welt ein, mit der Schifffahrt nach Europa. Hier ist Rotpeters physische Freiheit soweit eingeschränkt, dass er sich in seinem Käfig nicht einmal bewegen kann. Seinen anfänglichen Zustand auf dem Schiff beschreibt er wie folgt:
Ich hatte doch so viele Auswege bisher gehabt und nun keinen mehr. […] Hätte man mich angenagelt, meine Freizügigkeit wäre dadurch nicht kleiner geworden. […] Ich hatte keinen Ausweg, musste ihn mir aber verschaffen, denn ohne ihn konnte ich nicht leben. (304)
Diese bis dahin unbekannte Ausweglosigkeit und sein Überlebenswille lassen ihn einen „besonderen Ausweg, diesen Menschenausweg“ (312) entdecken, der jedoch nicht in die Freiheit führe, wie er betont: „Nein Freiheit wollte ich nicht. Nur einen Ausweg […], sollte der Ausweg auch nur eine Täuschung sein […]. Nur nicht mit aufgehobenen Armen stillestehn, angedrückt an eine Kistenwand.“ (305)
Der Ausweg, der weder Freiheit noch Gefangenschaft bedeutet, ist der, die Menschen, die ihn gefangen halten, nachzuahmen um seinen tierischen Körper in einen gesellschaftlich anerkannten Körper umzuformen. An den Menschen um ihn herum schaut er sich ihre typischen Gesten ab. Nicht nur diese, sondern ihre gesamte Erscheinung sei recht universell, betont er: „immer die gleichen Gesichter, die gleichen Bewegungen, oft schien es mir, als wäre es nur einer“ (307). Diesen standardisierten menschlichen Bewegungsmustern entsprechend formt Rotpeter seinen Körper um. Eine Unterwerfung unter das choreographische Gesetz, die er selbst mit den Worten „Verzicht auf jeglichen Eigensinn war das oberste Gebot“ (299), kommentiert. Wenn er den Normen menschlicher Bewegungen und Manieren entspreche, dürfe er den engen Käfig verlassen, hofft Rotpeter.
Dass Rotpeter in der nicht näher bezeichneten Institution von Gelehrten überhaupt angehört wird, ermöglicht erst seine Anpassung, durch die er als ihnen ähnlich angesehen wird. Rotpeters eigene Beschreibung dieser Situation macht deutlich, dass er – mit Siegmund (und Michel Foucault, auf den Siegmund jedoch nicht explizit hinweist) gesprochen – Subjekt im doppelten Sinne ist, der Choreographie der Zivilisation ebenso unterworfen wie von ihr hervorgebracht.[32]
Von der alten Affenweisheit zur instrumentellen Vernunft
Über den zum Zeitpunkt der Suche nach einem Ausweg gefassten Entschluss, das, was von seiner tierischen Vergangenheit noch übrig sei, endgültig hinter sich zu lassen – „nun, so hörte ich auf, Affe zu sein“ –, kann derjenige Rotpeter vor der Akademie im Nachhinein nur konstatieren, dass er damals auf dem Schiff diesen „klare[n], schöne[n] Gedankengang“ irgendwie mit seinem Bauch „ausgeheckt“ haben müsse: „denn Affen denken mit dem Bauch“ (alle 304). Das menschliche Denken kennzeichnet Rotpeter demgegenüber als zielorientiertes Schlussfolgern, als ein Rechnen (vgl. 307), dem er sich nach und nach angenähert habe: „Ich kann natürlich das damals affenmäßig Gefühlte heute nur mit Menschenworten nachzeichnen“ (303), beschreibt Rotpeter, wie sich durch seine körperliche Transformation sein Denken verändert habe. Die These, dass aus einer Veränderung der leiblichen Position in der Welt und zur Welt ein anderes Denken entsteht, die Kafka hier mit Rotpeters Vortrag aufstellt, wird auch von der Tanzwissenschaftlerin Maxine Sheets-Johnstone nahelegt. Sheets-Johnstone setzt das Rechnen und die aufrechte menschliche Körperhaltung in einen entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhang. Für die frühen Hominiden habe die Umstellung vom Vier- zum Zweibeiner durch die Aufrichtung des Oberkörpers einen in die Ferne gerichteten Blick sowie die Benutzung der Hände für das Erkennen von Mengen durch deren ins Verhältnissetzen zu den Fingern ermöglicht. Gleichzeitig sei mit dem aufrechten Gang die Körperorganisation vereinfacht worden: Die Schrittfolgen verliefen weniger rhythmisch als mit vier Beinen, die räumliche Orientierung veränderte sich zu einfacheren, binären Gegensätzen von vorne/hinten, oben/unten, rechts/links.[33] In diesen binären Parametern des geometrisch-euklidischen Raumverständnisses erinnert Rotpeter seine Gefangenschaft:
Nach jenen Schüssen erwachte ich – und hier beginnt allmählich meine eigene Erinnerung – in einem Käfig im Zwischendeck des Hagenbeckschen Dampfers. Es war kein vierwandiger Gitterkäfig; vielmehr waren nur drei Wände an einer Kiste festgemacht; die Kiste also bildete die vierte Wand. Das Ganze war zu niedrig zum Aufrechtstehen und zu schmal zum Niedersitzen. Ich hockte deshalb mit eingebogenen, ewig zitternden Knien, und zwar, da ich zunächst wahrscheinlich niemanden sehen und immer nur im Dunkel sein wollte, zur Kiste gewendet, während sich mir hinten die Gitterstäbe ins Fleisch einschnitten. […] Ich war zum erstenmal in meinem Leben ohne Ausweg; zumindest geradeaus ging es nicht; geradeaus vor mir war die Kiste, Brett fest an Brett gefügt. Zwar war zwischen den Brettern eine durchlaufende Lücke, die ich, als ich sie zuerst entdeckte, mit dem glückseligen Heulen des Unverstandes begrüßte, aber diese Lücke reichte bei weitem nicht einmal zum Durchstrecken des Schwanzes aus und war mit aller Affenkraft nicht zu verbreitern. (302 f., Hervorhebungen L.O.)
Obwohl er seine „Affennatur“ zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz „unterdrückt“ (beide 301) gewesen sei, kann er im Nachhinein „die alte Affenwahrheit nicht mehr erreichen“ (303), sondern die Situation nur noch in Kategorien von meist von Lebewesen, die als menschlich definiert werden, aufgeführten Bewegungen beschreiben: Aufrechtstehen, Sitzen, den Richtungsangaben ‚vorne‘ und ‚hinten‘.
An Rotpeters Schilderung dieser ersten Situation, an die er sich selbst erinnern kann und die ihm nicht bloß aus Erzählungen bekannt ist, (vgl. „hier beginnt allmählich meine eigene Erinnerung“ (302)), verblüfft bei genauerer Beachtung, dass Rotpeter im Zusammenhang mit seiner Erklärung, dass er nicht durch die Gitterstäbe blicken wollte, die Bezeichnung „vierte Wand“ (302), eine seit Denis Diderots Theatertheorie bekannte Bezeichnung für die am Rand der Bühne vorgestellte „große Mauer“,[34] die die Schauspielenden des neuzeitlichen Illusionstheaters imaginär von ihrem Publikum trennt, für die Kistenwand vor ihm benutzt. Hier deutet sich bereits an, dass der Ausweg Rotpeters schließlich doch geradeaus vor ihm liegt: auf den Bühnen der Varietés.
Kafka unterlegt Rotpeters Narration mit einer geradlinig von der Vergangenheit in die Zukunft weisenden Linearität, die ebenso unterstreicht, dass es für Rotpeter kein Zurück gibt, wie dass er über einen ausgeprägten Fortschrittsglauben verfügt.
Wird er anfänglich noch der (Waffen-)Macht der Jadgexpedition unterworfen, unterwirft er seinen Körper zunehmend dem eigenen Willen. Seine Selbstdisziplinierung geht so weit, dass er die Bestrafung seines Lehrers gutheißt, ihn und sich selbst „auf der gleichen Seite gegen die Affennatur“ (310) kämpfen sehend. Anstatt zu drohen, den Dresseur zu zerfleischen (wie noch Hagenbecks Raubtiere[35]), droht Rotpeter, sich selbst zu zerfleischen. Er geht dabei unbarmherziger als seine Dompteure vor: „Man beaufsichtigt sich selbst mit der Peitsche; man zerfleischt sich beim geringsten Widerstand“ (311). Stolz klingen seine Worte dabei: „Diese Fortschritte! Dieses Eindringen der Wissensstrahlen von allen Seiten ins erwachende Hirn!“ (312)
Das, was Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung als „das Destruktive des Fortschritts“[36] bezeichnen, beachtetet er nicht. Gerade dadurch wird an seinem Vortrag deutlich, wie sich sein Denken im Laufe dieser persönlichen Aufklärung von einer Art ganzheitlichem Bauchgefühl über das Nachahmen des menschlichen Rechnens zu einer über den Körper verfügenden „instrumentellen Vernunft“[37] transformiert.
Für das Verhalten seiner Jäger, Wächter und Dresseure findet Rotpeter Worte des Verständnisses, wenn nicht sogar der Sympathie und beginnt, sich verächtlich von allem Tierischen abzugrenzen und das Tier sowie das Tier im Menschen als solches zu beschimpfen (vgl. 301 f.). Adorno vertritt die These, dass der kantianisch-idealistische Anthropozentrismus der Aufklärung noch über die bereits zuvor übliche abendländische Abgrenzung vom Tier hinausgehe: Er hasse es. Davon ausgehend, dass es als Beleidigung gilt, jemanden ein Tier zu schimpfen, zieht Adorno eine Parallele vom Umgang mit Tieren zum nationalsozialistischen Umgang mit der jüdischen Religion angehörigen Personen.[38] Diese Parallele spielt zweifellos auch im Bericht für eine Akademie eine bedeutende Rolle. Indem Kafka denjenigen, der der menschlichen Gesellschaft nicht angehört, als Tier darstellt, spitzt er zu, dass das, was als menschlich gilt, stets von Normen vorgeschrieben wird. Kafka entwirft mit Rotpeter eine Figur, die aufgrund ihrer Nichtzugehörigkeit zu dem, was als Mensch definiert wird auch als politisch ausgeschlossene und verfolgte Person gelesen werden kann, die trotz ihrer Assimilation nur als ausgeschlossene in die Gesellschaft aufgenommen wird.[39]
Ein Abstand zum choreographischen Gesetz?
Rotpeter macht deutlich, dass die Nachahmung der Menschen für ihn eine Notwendigkeit und kein Vergnügen ist: Es fällt ihm leicht (vgl. 308), doch es reizt ihn nicht (vgl. 311). Als Höhepunkt seiner Annäherung an die Menschen stellt er dar, dass es ihm sogar gelingt, eine Schnapsflasche zu leeren, was ihm während seines Lernprozesses die meisten Schwierigkeiten bereitetet habe. Nach dieser perfekten Mimesis, die er „nicht mehr als Verzweifelter, sondern als Künstler“, einem „großen Zuschauerkreis“ (beide 310) vorführt, ist er sofort in die menschliche Gemeinschaft aufgenommen. Die Gitterstäbe, die Rotpeter einige Sätze zuvor noch isolierten, lässt Kafka ohne ein weiteres Wort fallen. Außerdem gelingt es Rotpeter sogar, ein „Hallo!“ von sich zu geben (311), ohne Zeit damit verbracht zu haben, die menschliche Sprache zu erlernen. Auch wenn er seine menschliche Stimme danach wieder für einige Monate verliert, braucht das Sprechen in dieser Erzählung weit weniger Training als das Erlernen der Choreographie menschlichen Bewegens und Verhaltens (vgl. 311). Genaugenommen geht es, wie sein verändertes Denken, einfach damit einher.
Rotpeters Anpassung reicht, trotz all seiner Anstrengungen, nicht aus, um ihm ganz zur Aufnahme in die menschliche Gesellschaft zu verhelfen:
Als ich in Hamburg dem ersten Dresseur übergeben wurde, erkannte ich bald die zwei Möglichkeiten, die mir offen standen: Zoologischer Garten oder Varieté. Ich zögerte nicht. Ich sagte mir: setze alle Kraft an, um ins Varieté zu kommen; das ist der Ausweg; Zoologischer Garten ist nur ein neuer Gitterkäfig; kommst du in ihn, bist du verloren. (311)
Rotpeter hält also am Ausweg der Choreographie fest, als die Schiffsreise beendet ist. So kann er sich in eine bestimmte Art der Menschenfreiheit flüchten, die er als „selbstherrliche Bewegung“ (305) bezeichnet – eine Wortwahl, welche die Hybris der menschlichen Naturbeherrschung und die der menschlichen Selbstbeherrschung verknüpft. Rotpeter verwendet sie in folgendem Zusammenhang:
Nebenbei: mit Freiheit betrügt man sich unter Menschen allzuoft. Und so wie die Freiheit zu den erhabensten Gefühlen zählt, so auch die entsprechende Täuschung zu den erhabensten. Oft habe ich in den Varietés vor meinem Auftreten irgendein Künstlerpaar oben an der Decke an Trapezen hantieren sehen. Sie schwangen sich, sie schaukelten, sie sprangen, sie schwebten einander in die Arme, einer trug den andern an den Haaren mit dem Gebiß. ‚Auch das ist Menschenfreiheit‘, dachte ich, ‚selbstherrliche Bewegung.‘ Du Verspottung der heiligen Natur! Kein Bau würde standhalten vor dem Gelächter des Affentums bei diesem Anblick. (304 f.)
Rotpeter beendet seinen Bericht damit, dass er in den Varietés als dressiertes Tier ausgestellt, für seine enorme Selbstdisziplinierung bewundert und berühmt, und zu „Banketten, […] wissenschaftlichen Gesellschaften, […] gemütlichem Beisammensein“ geladen wird. Von der zivilisierten Gesellschaft zugleich ein- und ausschlossen, verbringe er nur seine Nächte noch „nach Affenart“. Erst hier, ganz am Ende des Berichts erwähnt Rotpeter ein weiblich konnotiertes Wesen. Dieses ist weit weniger als er selbst in die Gesellschaft der männlichen Menschen integriert, die bis dahin in Rotpeters Vortrag vorkamen oder diesem zuhören. Die kleine Schimpansin, deren zurückgebliebene Wildheit Rotpeter bei Nacht zu mögen scheint, ist, in seinen Worten, „halbdressiert […]“, und passt, da sie „den Irrsinn des verwirrten dressierten Tieres im Blick“ (alle 313) hat, nicht in sein gesellschaftskonformes Leben bei Tag. Die Rolle der Frau in einer die Natur zu beherrschen versuchenden „Männergesellschaft“[40] liegt nicht in der Produktion, sondern der Reproduktion, insbesondere der „Verkörperung der biologischen Funktion“,[41] bringen schon Adorno und Horkheimer das zentrale Argument des marxistischen Feminismus vor.
Obgleich Rotpeter die Geschichte seiner Menschwerdung als Geschichte einer Assimilation erzählt, macht er an mehreren Stellen seines Berichts deutlich, dass er, wenngleich er seine Assimilation erfolgreich meistert, Außenseiter bleibt. Beeindruckt er in seinen Auftritten im Varieté damit, wie weit seine Menschwerdung reicht, thematisiert er in seinem Auftritt vor der Akademie, dass das Verhältnis seines Körpers zur zivilisatorischen Choreographie davon gekennzeichnet bleibt, dass die beiden Seiten nicht ganz ineinandergreifen: sein Körper geht nicht ganz im choreographischen Gesetz auf, dieses wiederum kann den Körper nicht vollständig ergreifen. Das, worauf Rotpeter hiermit aufmerksam macht – und was er zugleich nutzt, um überhaupt darauf aufmerksam machen zu können – ließe sich mit Siegmund als ein möglicher „kritische[r] Abstand zwischen Körper und Gesetz“[42] bezeichnen. Rotpeters Vortrag verdeutlicht, dass dieser kritische Abstand gerade dadurch offengehalten werden könnte, die eigene Transformation durch die zivilisatorische Choreographie nicht zu leugnen oder sich ihr zu widersetzen zu versuchen, aber auch nicht Bewegung einfach in ihrer Selbstherrlichkeit vorzuführen, sondern das eigene Unterworfen- sowie Hervorgebrachtsein durch die zivilisatorische Choreographie zur Sprache zu bringen.
Deutlich macht die Balance des Affen auf der Grenze zwischen Mensch und Tier so außerdem, dass bereits ein gewisser Einschluss in die zivilisatorische Choreographie mit Rotpeter vonstattengehen muss, bevor eine Unterwerfung unter das, was hier als zivilisatorische Gesetz bezeichnet wurde, überhaupt stattfinden kann. Hinsichtlich dieses Aspekts lässt sich eine Parallele zwischen Kafkas Figur des Affen und der Figur des Flüchtlings bei Giorgio Agamben, die Agamben im Rückgriff auf Hannah Arendts Diskussion der „Aporien der Menschenrechte“[43] behandelt. „Die Paradoxie, die von Anfang an in dem Begriff der unveräußerbaren Menschenrechte lag, war, daß dieses Recht mit einem ‚Menschen überhaupt‘ rechnete, den es nirgends gab“[44], analysiert Arendt in Bezug auf die 1789 in Frankreich verabschiedete Declaration des droit de l’homme et du citoyen ebenso wie die 1948 erfolgte Verabschiedung der allgemeinen Menschenrechte. Wen auf nationaler Ebene verabschiedete Gesetze und Erlasse aus der nationalstaatlichen Lebensform ausschließen, die oder der verliert mit seiner Staatsangehörigkeit auch die mit dieser garantierten Rechte und wird damit, als Staatenlose oder Staatenloser, in ein Außerhalb des Gesetzes katapultiert, konstatiert Arendt.[45] Agamben dazu:
Das Paradox, von dem sie hier ausgeht, besteht darin, daß die Figur – der Flüchtling –, die den Menschen der Menschenrechte schlechthin hätte verkörpern sollen, statt dessen die radikale Krise dieser Konzeption bezeichnet[46].
Kafkas Figur des Affen Rotpeters unterstreicht, dass das Problem noch drastischer darzustellen ist, als Arendt und Agamben es abbilden: Nicht nur der Nexus von Nativität und Nationalität, das heißt von Geburt und Staatsangehörigkeit ist eine Konstruktion,[47] sondern auch derjenige von Geburt und Anerkennung als Mensch. Aufmerksam macht Rotpeter damit nicht zuletzt darauf, dass das anthropozentrisch organisierte Theater stets nur auf einer solchen die Idee des Menschen manifestierenden und normalisierenden Choreographie gründen kann – womit sich sein Bericht für eine Akademie als eine theater- und tanzwissenschaftlich höchst aktuelle Theorie liest.
- Kafka, Franz: „Ein Bericht für eine Akademie“, in: ders.: Franz Kafka. Schriften Tagebücher Briefe. Kritische Ausgabe. Drucke zu Lebzeiten. Frankfurt a. M. 1994, S. 299-313, hier S. 299. Diese Ausgabe wird nachfolgend im Text durch Seitenangaben in Klammern zitiert. Erstmals erschien der Text als: „Zwei Tiergeschichten. 2. Ein Bericht für eine Akademie“, in: Der Jude (1917), S. 559-565. ↑
- Kafka: „Ein Bericht für eine Akademie und andere Texte zum Rotpeter-Thema“, in ders.: Die Erzählungen und andere ausgewählte Prosa. Frankfurt a. M. 2001, S. 294-307, 2. beigefügtes Fragment, hier S. 306. ↑
- Arbeau, Thoinot: Orchésographie, Réimpression précédée d’une Notice sure les Danses du XVIe siècle par Laure Fonta, Bibliotheca Musica Bononiensis. Nachdruck der Ausgabe Paris 1888, Bologna 1981. ↑
- Lepecki, André: Option Tanz. Performance und die Politik der Bewegung. Berlin 2008, S. 17. ↑
- Ebd. S. 15. ↑
- Vgl. Arbeau: Orchésographie. S. 3 ff. ↑
- Siegmund, Gerald: „Recht als Dis-Tanz: Choreographie und Gesetz in William Forsythes Human Writes“, in: Forum Modernes Theater, 22/1/2007, S. 75-93, hier S. 82. Im Einzelnen verwendet Arbeau für die zu überwindende kreatürliche Körperlichkeit die Worte „espaule de mouton“ (Hammelschulter), „coeur de porc“ (Schweineherz) und „teste d’asne“ (Eselskopf). Vgl. Arbeau: Orchésographie, S. 6. ↑
- Siegmund: „Recht als Dis-Tanz“, S. 81. ↑
- Ebd. S. 82. ↑
- Adorno, Theodor W./Horkheimer, Max: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente in: Theodor W. Adorno. Gesammelte Schriften, Bd. 3. Frankfurt a. M. 1984, S. 283. ↑
- Ebd. ↑
- Wild, Markus: Tierphilosophie zur Einführung. Hamburg 2008, S. 27. ↑
- Ebd. S. 26. Gemein ist den oben erwähnten Abgrenzungsversuchen, dass sie mit dem in einem verallgemeinernden Singular stehenden Begriff Tier die nicht einholbare Fremdheit der einzelnen Tierarten und Tiere negieren, worauf Jacques Derrida unter anderem in seinem Buch L’animal que donc je suis mit seinem Versuch, einem bisher vernachlässigten Thema der Philosophie zu eingehenderen Untersuchungen zu verhelfen, eindringlich hinweist. Die Reduzierung der Vielfalt der Tiere auf die Rede von „dem Tier“ will er durch den Entwurf des Wortes „animot“ (meist ins Deutsche übersetzt als das „Tierwort“), das klanglich auf den Plural „les animaux“ verweist, umgehen. Derrida, Jacques: Das Tier, das ich also bin. Wien 2010, S. 58. ↑
- Vgl. Aristoteles: Werke in deutscher Übersetzung, Bd. 9, Politik, Teil 1. Darmstadt 1991, S. 13 (1253a). ↑
- Vgl. Kant, Immanuel: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Stuttgart 1983, S. 278. ↑
- Vgl. Descartes, René: Die Welt. Abhandlung über das Licht. Der Mensch. Französisch-Deutsch. Hamburg 2015, S. 173 ff. ↑
- Vgl. Deleuze, Gilles/Guattari, Félix: Kafka. Für eine kleine Literatur. Frankfurt a. M. 1976, S. 50. ↑
- Vgl. Linné, Carl von: „Vom Thiermenschen“, in: Des Ritters Carl von Linné Auserlesene Abhandlungen aus der Naturgeschichte, Physik und Arzeneywissenschaft, Bd. 1. Leipzig 1776, S. 57-70. Vgl. dazu auch Agamben, Giorgio: Das Offene. Der Mensch und das Tier. Frankfurt am Main 2003, S. 65 ff. ↑
- Rousseau, Jean-Jacques: Diskurs über die Ungleichheit. Kritische Ausgabe des integralen Textes. Paderborn u.a. 1997, S. 71. Das Traktat entstand als Antwort auf eine am 13. Juli 1753 von der Académie de Dijon gestellte Frage: „Welches ist der Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen, und ob sie durch das natürliche Gesetz autorisiert wird?“. Rousseaus Traktat gewann den von der Akademie ausgeschriebenen Prix de marche des Jahres 1754 nicht und wurde 1755 in Amsterdam veröffentlicht. Vgl. die Anmerkungen des Herausgebers und Übersetzers Heinrich Meier auf S. 64 f. ↑
- Heinrich Meier: „Rousseaus Diskurs über die Ungleichheit – Ein einführender Essay über die Rhetorik und die Intention des Werkes“, in: Rousseau: Diskurs über die Ungleichheit, S. XXI-LXXVII, hier S. LXVI. ↑
- Ebd. S. LXX. ↑
- Rousseau: Diskurs über die Ungleichheit. S. 105. ↑
- Ebd. S. 331. ↑
- Das vom Abbé Antoine François Prévost von 1746 bis 1791 herausgegebene 20 Bände umfassende Werk lag 1754 bereits mit den ersten sieben Bänden vor. Diese sind eine Übersetzung der 1741 bis 1754 in London von John Green veröffentlichten New Collection of Voyages and Travels. Vgl. die Anmerkungen Meiers in: Rousseau: Diskurs über die Ungleichheit, S. 326 ff. ↑
- Ebd. S. 325 ff. „Orang-Utang“ meinte damals auch die Affenarten, die heute Schimpansen und Gorillas genannt werden. Vgl. ebd. S. 334. ↑
- Ebd. S. 333. ↑
- Ebd. S. 335. ↑
- Vgl. Derrida, Jacques: Grammatologie. Frankfurt a. M. 1974, S. 244 ff. und S. 248 ff. Stephan Gregory macht mit Paul de Man darauf aufmerksam, dass Rousseau in seiner Gesellschaftstheorie schon einen Schritt weiter sei als Derrida in seiner Lektüre annehme, weil Rousseau selbst schon berücksichtige, dass seine Überlegungen über einen Urzustand immer schon von seiner Zeitgenossenschaft geprägt und damit verfälscht seien. Vgl. Gregory, Stephan: „Rousseaus Experimente: Wie man zur Natur zurückkehrt“, in: Maud Meyzaud (Hg.): Arme Gemeinschaft. Die Moderne Rousseaus. Berlin 2015, S. 20-48, hier S. 21 sowie 26 f. ↑
- Vgl. Binder, Hartmut: Kafka: Der Schaffensprozeß. Frankfurt am Main 1983, S. 271-305. ↑
- Vgl. Hagenbeck, Carl: Von Tieren und Menschen. Erlebnisse und Erfahrungen. Hamburg 2012 [1908], S. 212, S. 217. Vgl. zu der fragwürdigen Begeisterung für durch Dressur vermenschlichte Affen auch die Forschung Donna Haraways in: dies.: Primate Visions: Gender, Race and Nature in the World of Modern Science. New York 1989, S. 21. ↑
- Hagenbeck: Von Tieren und Menschen, S. 212. Anselm Franke, Ko-Kurator der am Haus der Kulturen der Welt gezeigten Ausstellung Ape Culture bezeichnet Affen als „Gefangene des Spiegels“, als welcher sie die Menschen aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit ihnen faszinieren. Lediglich daraufhin betrachtet, was sie Menschen über diese selbst verraten, dienen sie der Forschung vor allem dann, wenn es menschenähnliche Körpern oder menschenähnliches Verhalten verlangt. Franke, Anselm: „Spiegel an Grenzen“, in: Ders./Peleg, Hila (Hg.): Ape Culture / Kultur der Affen, Leipzig 2015, S. 12-23, hier S. 12. ↑
- Gerald Siegmund zeigt, dass es zu kurz greift, Choreographie im Sinne Lepeckis auf das „ihr inhärente Moment der Unterdrückung von Körperlichkeit zu reduzieren“. Er macht deutlich, dass das Verhältnis des Einzelnen zur Choreographie vielmehr im Sinne Foucaults als Subjektivierung zu verstehen sei. Vgl. Siegmund: „Recht als Dis-Tanz“, S. 81. Vgl. zu Foucaults (spätem) Subjektbegriff beispielsweise Foucault, Michel: „Subjekt und Macht“, in ders.: Schriften in vier Bänden. Band IV. Frankfurt am Main 2005, S. 269-294. ↑
- Sheets-Johnstone, Maxine: The Roots of Thinking. Philadelphia 1990, S. 71-89. Vgl. zu dieser mit einer bestimmten Prägung des Verhältnisses der Menschen zur Welt verknüpften Körperlichkeit auch Adorno/Horkheimer: Dialektik der Aufklärung, S. 265 ff. ↑
- Vgl. Diderot, Denis: „Von der dramatischen Dichtkunst“, in: Bassenge, Friedrich (Hg.): Denis Diderot. Ästhetische Schriften. Frankfurt a. M. 1968, S. 239-347, hier S. 284. ↑
- Hagenbeck versteht seine neue, vermeintlich humanistischere Methode „zahme Dressur“: „Die Zeiten der Gewaltdessuren sind jetzt vorbei, schon deshalb, weil man mit Gewalt nicht den hundertsten Teil dessen erreichen kann, was sich mit Güte erzielen läßt. Aus diesem Grunde habe ich aber seinerzeit die zahme Dressur nicht eingeführt, sondern es geschah aus Mitgefühl und aus der Erwägung, daß es einen Weg zur Psyche des Tieres geben muß. […] Die Tiere besitzen ein feines Unterscheidungsvermögen in Bezug auf die Art, wie man ihnen begegnet, sie sind fähig, Freundschaften zu schließen, auch mit dem Menschen […].“ Ders.: Von Tieren und Menschen, S. 166 f. Vgl. zu Hagenbecks Zooreformen Adorno: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt am Main 2001, S. 211 ff. ↑
- Adorno/Horkheimer: Dialektik der Aufklärung, S. 13. ↑
- Horkheimer: Gesammelte Schriften, Bd. 6, „Zur Kritik der instrumentellen Vernunft“ und Notizen 1949-1969. Frankfurt a. M. 1991. ↑
- Vgl. Adorno: Nachgelassene Schriften, Abt. 1, Fragment gebliebene Schriften, Bd. 1, Beethoven. Philosophie der Musik. Fragmente und Texte. Frankfurt a. M. 1993, S. 123. Siehe auch Adorno/Horkheimer: Dialektik der Aufklärung, S. 290 f. ↑
- Hannah Arendt hat aufgezeigt, dass das Thema der Assimilation in Kafkas Schriften immer wieder auszumachen ist. Vgl. Arendt, Hannah: Die verborgene Tradition. Essays. Frankfurt a. M. 1976, S. 72 ff. ↑
- Adorno/Horkheimer: Dialektik der Aufklärung, S. 286. ↑
- Ebd. S. 285. ↑
- Siegmund: „Recht als Dis-Tanz“, S. 78. ↑
- Arendt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. II. Imperialismus. München 1995, S. 452. ↑
- Ebd. S. 454. ↑
- Vgl. ebd. S. 422 ff. ↑
- Agamben: Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben. Frankfurt am Main 2002, S. 135. ↑
- Vgl. ebd. S. 140 f. ↑